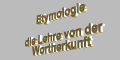"§"
Tracht Prügel (W3)
Die "Tracht Prügel" hat nichts mit einer Trachtengruppe zu tun, die nach einem Prügel trachtet.
Das heißt, sprachlich gesehen besteht durchaus ein Zusammenhang.
Die dt. "Tracht" geht zurück auf dt. "tragen" und bezeichnet "das Getragene" (man könnte es auch "das Angezogene" nennen).
Das Verb dt. "trachten" geht zurück auf lat. "tractare" = dt. "behandeln", "traktieren", "betasten", "anfassen", "handhaben", "bearbeiten". In dt. "betrachten" findet man noch die allgemeine Bedeutung "erwägen". Man findet lat. "tractare" auch in dt. "malträtieren" (= dt. "schlecht behandeln", das kann auch in Form einer "Tracht Prügel" geschehen, zu frz. "traiter" = dt. "behandeln", frz. "traiter qn" = dt. "jemanden behandeln"), dt. "Traktat" (= dt. "Abhandlung") und in dem aus dem Italienischen übernommenen ital., dt. "Trattoria" (= dt. "Speiselokal", zu ital. "trattare" = dt. "verpflegen", "beköstigen").
Und hier scheint sich eine Verbindung zwischen lat. "tractare" und dt. "tragen" zu ergeben. In einem Speiselokal werden Speisen "aufgetragen". Und genau das ist eine inzwischen nicht mehr bekannte Bedeutung von dt. "Tracht" = dt. "aufgetragene Speise". Die "Tracht Prügel" erweist sich also als ein ironischer Vergleich mit einem "Gericht, das jemandem serviert wird".
Adelung führt dt. "Tracht Prügel" aber auch direkt auf die Bedeutung "so viel Prügel wie jemand ertragen kann" zurück.
Neben der Bedeutung dt. "tragen" zieht sich der Bedeutungsumfang von lat. "tractare" auch zu dt. "ziehen". Diesen Bedeutungszweig findet man z.B. in dt. "Traktor", der landwirtschaftlichen "Zugmaschine" und in dt. "Trakt", dem sich hinziehenden Gebäudeteil oder dem "Verdauungstrakt". Dahinter stößt man auf lat. "trahere" = dt. "ziehen", "zerren", "schleppen", "hervorziehen", "herausziehen", "in die Länge ziehen" und "hinhalten".
Adelung sieht in dt. "träge" sowohl die Konnotation zu "schwer an etwas tragen" als auch "sich hinziehen", indem er erklärt:
...
Daß diese Zeitwörter von unserm "tragen" abstammen, so fern es ehedem auch "ziehen", lat. "trahere", bedeutete, ist höchst wahrscheinlich, indem zwischen beyden Begriffen mehr als eine Verbindung Statt findet.
...
Die Linguisten bezeichnen lat. "tractare" als eine Intensivbildung zu lat. "trahere". Beide Bedeutungsrichtungen - dt. "tragen" und dt. "ziehen" - kann man vielleicht in dt. "schleppen" zusammenfassen.
Und so verwundert es auch nicht, wenn man auch auf engl. "trace" = dt. "Zugriemen", "Strang", aber auch dt. "Spur" und auf Ableitungen wie engl. "traceable" = dt. "nachweisbar", stößt.
Und plötzlich findet man sich mit engl. "Traceroute" auch in der Welt des Internets. "Traceroute" bezeichnet ein Programm, das in der Lage ist, den Pfad eines Datenpaketes in einem paketvermittelten Netzwerk nachzuvollziehen und optisch darzustellen. Und auch engl. "Trace" bzw. "trace back" findet man in der Datenverarbeitung, als "Rückverfolgung" eines Variablenwertes bis zum Auftreten des Fehlers. Engl. "tracing service" bezeichnet einen dt. "Suchdienst". Mit engl. "track" = dt. "Spur" bzw. mit engl. "Trackball" einem Eingabegerät auf der Tastatur gibt es einen weiteren Bezug zur Computerei. Englische Wortbildungen mit "track" könnten wahrscheinlich eine weitere halbe Seite füllen. Auch engl. "trail" bedeutet dt. "Spur" und hat einige Ableger gebildet, wie etwa den "Trailer", den dt. "Vorfilm". Und dann gibt es noch frz., engl. "Train" = dt. "Zug".
Einige weitere Familienmitglieder sollen aber auch noch erwähnt werden, wie etwa frz. "balle traçante" = dt. "Leuchtspurgeschoss", ital. "traccia" = dt. "Spur", "Entwurf", "Skizze", ital. "tracciare" und damit auch dt. "trassieren" und dt. "Trasse", span. "tracción" = dt. "Ziehen", "Zug".
Als deutsches Familienmitglieder findet man dt. "trächtig". Ein weniger bekanntes Wort ist dt. "Traille" = dt. "Fähre" bzw. "Fährseil", an dem eine Fähre entlangläuft. Dt. "Treille" ist die Bezeichnung für ein dt. "Gitterwerk", "Geländer". Dt. "trainieren" geht auf das Verb engl. "train" = wörtlich dt. "erziehen", "ziehen" und weiter auf frz. "traîner" = dt. "ziehen" zurück. Vermutlich gehört auch frz. "traire" = dt. "melken" zur Familie, wie auch frz. "Traité" = dt. "Vertrag", "Abhandlung", "Traktat". Fehlen dürfen auch nicht dt. "extrahieren", "kontrahieren" und "subtrahieren". Und auch "Eintracht" und "Zwietracht" sollen erwähnt werden.
In der Anatomie stößt man auf med. "Tractus" = dt. "Bündel von Nervenfasern des Zentralnervensystems", wörtlich dt. "Zug".
Die nicht erwähnten Familienmitglieder mögen es mir nachsehen, wenn ich nicht jede Beziehungsspur bis zum bitteren Ende verfolge.
Alles fing ganz harmlos mit einer "Tracht Prügel" an und nun sind wir einer bedeutungstragenden Wortfamilie auf die Spur gekommen.
Bei Adelung findet man:
Die "Tracht", plur. die -en, von dem Zeitworte "tragen".
1. Ein Ding, welches trägt, doch nur in einigen Fällen. Ein Schulterjoch, Eimer mit Wasser und andere Lasten daran zu tragen, heißt in Niederdeutschland eine "Tracht", Nieders. "Dragt". Ingleichen in der Baukunst: Man muß dem Balken mit Trägern zu Hülfe kommen, oder ihm sonst hinlängliche Tracht verschaffen, wo es doch ein Abstractum zu seyn, und den Zustand, da etwas getragen wird, zu bezeichnen scheinet.
2. Was getragen wird, oder vielmehr so viel als auf Ein Mahl getragen wird, in verschiedenen Bedeutungen des Zeitwortes tragen.
1) In der eigentlichen. Eine Tracht Holz, so viel Holz, als ein Mensch auf Ein Mahl tragen kann. Zwey Trachten Wasser, in Meißen zwey Fahrten. Eine "Tracht Schläge", "Tracht Prügel", figürlich, so viel als jemand ertragen kann. In engerer Bedeutung ist eine "Tracht Speisen" nicht ein Gericht, wie es in einigen Wörterbüchern erkläret wird, sondern so viel Gerichte, als auf Ein Mahl aufgetragen und aufgesetzt werden, wofür auch das Wort Gang üblich ist.
2) Von "tragen", "schwanger", "trächtig seyn", ist eine Tracht junger Thiere, so viel Junge, als ein Thier auf Ein Mahl wirft, oder zur Welt gebieret. Eine Tracht Hunde, Katzen.
3) In einigen Gegenden sagt man auch die Tracht eines Ackers, so viel als er trägt, dessen Ertrag.
3. Die Art und Weise, wie man sich trägt, d. i. kleidet. Eine bequeme, beschwerliche, alberne Tracht. Die großen Reifröcke sind eine abenteuerliche Tracht. Die Pohlnische und morgenländische Tracht ist der Natur gemäßer, als die Französische. Die Tracht der Altenburgischen Bauern. Da es denn auch wohl für das Französische Mode gebraucht wird. Neue Trachten erdenken.
4. In einigen Gegenden wird auch die Ferse an dem Pferdehufe die "Tracht", Nieders. "Dragt" genannt, welches gleichfalls hierher zu gehören scheinet.
Anm. "Tracht" stammet auf eben die Art von "tragen" ab, wie "Schlacht" von "schlagen". Die Niederdeutschen schreiben es mit dem "g", "Dragt", und die Schweden "Drägt", dagegen im Hochdeutschen um des geschärften Tones willen das "g" in das "ch" übergegangen ist. In "Eintracht" und "Zwietracht" wird es auch als ein Abstractum von dem Zustande gebraucht, S. diese Wörter.
"Trachten", verb. reg. act. et neutr. welches im letzten Falle das Hülfswort haben erfordert.
1 * "Beobachten", "denken", "erwägen", sich das mannigfaltige an einem Dinge vorstellen; lauter längst veraltete Bedeutungen, von welchen die letzte noch in "betrachten" übrig ist, ( S. dasselbe.) Ottfried gebraucht "drahton" noch häufig für "betrachten" und "bemerken", "Drahta" für das "Nachdenken". In der Parän. Tir. kommt "Trahtu" für "Gedanken" vor.
2. Mit Anstrengung seiner Leibes- und Gemüthskräfte zu erlangen suchen, zum Ziele seiner angestrengten Bemühungen machen, wie streben und zuweilen auch ringen, doch unter andern Bildern. Es kommt in dieser Bedeutung auf gedoppelter Art vor. 1. * Als ein Activum mit der vierten Endung. "trachte nicht Böses wider deinen Freund", Sprichw. 3, 29. Ein loser Mensch trachtet allezeit Böses und Verkehrtes in seinem Herzen, Kap. 6, 14. In dieser Gestalt ist es im Hochdeutschen veraltet.
2) Als ein Neutrum, sowohl mit dem Infinitiv, oder einer Partikel. Saul trachtete David zu spießen, 1 Sam. 19, 10. Sie trachten Schaden zu thun, Ps. 35, 20. Sie trachteten, wie sie Jesum greifen möchten, Matth. 21, 46. Wir müssen das einheimische Laster der Familie am eifrigsten zu verbessern trachten, Gell. Als auch mit dem Hauptworte und dem Vorworte nach. Nach etwas trachten. Nach Ehre, nach Reichthum, nach einem Amte trachten. Jemanden nach dem Leben trachten. Unsere Eigenliebe trachtet mit allen brünstigen Wünschen nach einer ununterbrochene Freude, Dusch. Ehedem gebrauchte man es auch mit dem Vorworte auf, welche Form aber im Hochdeutschen veraltet sind. Wer auf übrig Reichthum tracht, Der wird weiter nichts erstreben, Logau. So auch das Trachten
Anm. Im Schwed. "tragta". Es ist ein vermittelst der Endsylbe "-ten", gebildetes Intensivum von "tragen", wie "schlachten" von "schlagen", wo denn der Übergang des gedehnten "a" in das geschärfte die Verwandelung des gelindern "g" in das härtere "ch" nothwendig macht. Diese intensive Form ist zugleich der Grund des Begriffes der Anstrengung, der mit diesem Worte verbunden ist. Unter andern veralteten Bedeutungen des Zeitwortes "tragen" wurde es auch für "sehen", und figürlich für "denken", "bedenken", "wollen", "verlangen" und andere Wirkungen des Geistes gebraucht. Auf ähnliche Art ist "sehnen" der Form nach ein Intensivum, der Bedeutung aber nach eine Figur von "sehen". "Tragen" selbst ist eine Art eines Intensivi von einem ältern "trahen", Lat. "trahere", welches noch in dem Schwed. "tra", "verlangen", übrig ist, von welchem die Intensiva "träga", "trängta" und "tragta", "sehnlich verlangen" und "trachten" bedeuten. S. "Tragen".
"Trächtig", -er, -ste, adj. et adv. welche Grade, doch nur in der veralteten ersten Bedeutung üblich sind, von "Tracht", in der veralteten Bedeutung so wohl des Ertrages, als auch einer Bürde.
1) * "Fruchtbar", "tragbar"; eine im Hochdeutschen veraltete Bedeutung, welche noch im Oberdeutschen gangbar ist. Den Erdboden trächtig machen, fruchtbar. Ein trächtiges Geländ, Bluntschli, ein fruchtbares Land. Die trächtigen Felder des Rheins, Opitz. Man hört mit Kümmerniß die böse Zeitung sagen Im trächtigen Peru, eben ders.
2) "Mit Leibesfrucht schwanger seyn", von den Thieren, wofür in der edlern Sprechart "tragbar" und "tragend" üblich ist. Eine trächtige Hündinn. Trächtig seyn, werden. Da denn auch wohl das Hauptwort die "Trächtigkeit" von dem Zustande üblich ist.
Anm. Im Nieders. "drägtig", Schwed. "drägtig". Es ist von "Tracht", eigentlich "Tracht habend". In "einträchtig", "zwieträchtig", "niederträchtig", hat es noch andere Bedeutungen.
"Träge", -r, -ste, adj. et adv. Abneigung von der Bewegung habend, besonders, so fern diese Abneigung in der Empfindung körperlicher Masse oder Schwere gegründet ist, und in weiterer Bedeutung, Abneigung zur möglichen Anwendung seiner Kräfte habend und darin gegründet; im gemeinen Leben faul. Träge seyn. Ein träger Mensch, Zur Arbeit träge seyn. Träge arbeiten. Was schlummerst du? die träge Katz Schickt sich für Helden nicht, Gleim. Daher wird es zuweilen auch für "schläserig", "müde", gebraucht, so fern dieser Zustand mit einer Neigung zur Ruhe, oder Abneigung von der Bewegung verbunden ist. Im Niedersächsischen bedeutet es auch "abgemattet", "entkräftet", in welchem Verstande es aber im Hochdeutschen ungewöhnlich ist. S. auch "Trägheit".
Anm. schon bey dem Kero "traga", bey dem Ottfried "drago", im Nieders. und Holländ. "traag", im Schwed, "trög", im Irländ. "tregur". Frisch fand, daß der Esel, weil er zum Tragen gebraucht wird, bey einigen ältern Schriftstellern "Trägel" genannt wurde, und daher kam er auf den seltsamen Einfall, unser "träge" von diesem Worte abzuleiten, weil die Trägheit eine bekannte Eigenschaft des Esels ist. Erträglicher würde die Ableitung von dem Schwed. "dryg", "groß", "schwer", Isländ. "driugr", srvn, indem die Trägheit eine Wirkung der Empfindung körperlicher Masse oder Schwere ist. Allein, alle verwandte Sprachen haben noch das Zeitwort, welches das nächste Stammwort unsers Beywortes ist, und dieses ist das Schwed. "dröga", "zaudern", im Isländ. "trega", im Ital. "tregare", im Schottländ. "dretche", im Lat. mit vorgesetztem Zischlaute "strigare", wovon denn das mittlere Lat. "tricare", "zaudern machen", "hindern", das Factitivum ist.
Daß diese Zeitwörter von unserm "tragen" abstammen, so fern es ehedem auch "ziehen", Lat. "trahere", bedeutete, ist höchst wahrscheinlich, indem zwischen beyden Begriffen mehr als eine Verbindung Statt findet. Daher wird das Franz. "trainer", (ehedem "traigner",) auch für "zaudern" gebraucht, und die gemeinen Deutschen Mundarten haben von dem alten "tragen", "zaudern", das doppelte Intensivum "drucksen". Das Latein. "tardus" scheinet auf ähnliche Art von einem veralteten "taren", "ziehen", abzustammen, wovon unser "zerren", Nieders. "terren", ein Iterativum ist.
"Tragen", verb. irreg. ich trage, du trägst, er trägt, Conj. ich trage; Imperf. ich trug, Conj. ich trüge; Mittelw. getragen; Imper. trage. Es ist so wohl als ein Activum, als auch als ein Neutrum üblich, welches im letztern Falle das Hülfswort haben erfordert. Es war ehedem von einem überaus weiten Umfange der Bedeutung, wovon aber manche Bedeutungen um der Vieldeutigkeit willen veraltet sind, und jetzt nur noch theils aus den Ableitungen, theils aus den verwandten Sprachen erkannt werden können. Die vornehmsten drey Bedeutungen dieses Wortes, deren jede wieder verschiedene figürliche als Unterarten hatte, sind:
1. * "Ziehen"; eine im Hochdeutschen veraltete Bedeutung, in welcher dieses Wort im Angels. "dragan", im Isländ. und Schwed. "draga", im Engl. "dragg" und "draw", im Franz. "trainer", ehedem "traigner", dem Intensivo vermittelst des "n", und im Lat. "trahere" lautet. Das noch Nieders. "trecken", "ziehen", ist ein Intensivum davon. Figürliche Bedeutungen waren davon unter andern:
1) "Reisen", Schwed. "draga". Unser "ziehen" und das Lat. "ducere" sind in ähnlichem Verstande üblich.
2), ( S. "Träge".) Auf ähnliche Art ist unser "zögern", ein Iterativum von "ziehen", so wie das gemeine "drucksen" von "drucken" und "tragen".
3) "Hintergehen", Schwed. "draga". Wir sagen dafür jetzt "triegen" und "betriegen", die Franz. "trahir". "Jemanden beziehen" ist in eben diesem Verstande üblich. Vielleicht gehöret hierher
4) auch die Bedeutung des "Sehens", "Erwägens", "Wollens" u. s. f. wovon wir noch die Intensiva "betrachten" und "trachten" haben. Im Schwed. bedeutet "draga" auch "zweifeln", und daß es auch "urtheilen" bedeutet haben müsse, erhellet aus dem noch nicht ganz veralteten "Austrag" und "austragen".
2. * "Drücken", eine längst veraltete Bedeutung, bey dem Ulphilas "threihan", im Angels. "threagan", im Schwed. "truga". Unser "drücken", "drängen" und "dringen" stammen noch davon ab.
3. Durch seine Kraft unterstützen, die einzige noch gangbare eigentliche Bedeutung, in welcher es so wohl als ein Activum, als auch als ein Neutrum gebraucht wird.
1) Als ein Activum, einen Körper durch seine Kraft unterstützen, es geschehe nun mit oder ohne Veränderung des Ortes.
(a) Eigentlich. Eine Last tragen, so wohl im Stande der Ruhe, als auch der Bewegung. Die Säule trägt das Dach, der Balken die Wand. Ein Kind auf den Armen, eine Last auf der Achsel, auf dem Kopfe, einen Stein in der Hand, Geld in der Tasche tragen. Etwas in der Tasche bey sich tragen. Eine Leiche zu Grabe tragen. Jemanden in der Sänfte tragen. Sich nach Hause tragen lassen. Etwas auf die Gasse, auf den Boden, vor die Thür, auf das Feld, in den Wald tragen. Briefe herum tragen. Etwas feil tragen, zur Schau tragen. Das Schiff trägt 500 Last, führet so viel, kann so viel tragen. Daher auch die figürlichen R. A. Jemanden auf den Händen tragen, ihm alle nur mögliche Pflege und Wartung erweisen. Sein Herz auf der Zunge tragen, so reden, wie man denkt. Du trägst dein gutes Herz in den Augen und auf der Zunge, ohne daß du daran denkst, Gell. Auf beyden Achseln tragen, zweyen widerwärtigen Personen zu Gefallen reden, den Mantel nach dem Winde hängen, ( S. Achselträger.) Sich nach Hause tragen, d. i. nach Hause gehen, ist nur im gemeinen Scherze üblich. Zuweilen wird es auch hier absolute und in Gestalt eines Neutrius gebraucht. Das Eis trägt, wenn es Personen oder Lasten trägt, ohne zu brechen.
(b) In engerer und figürlicher Bedeutung.
(1) Die Erde trägt Früchte, wenn Früchte auf ihr wachsen. Der Acker trägt Korn, Weitzen. Der Acker soll dir Dornen und Disteln tragen. Sandige Felder tragen nicht alle Jahre. Ingleichen von Gewächsen. Der Baum trägt Früchte, trägt viele Äpfel. Der Same trägt hundertfältig. Wo es auch absolute gebraucht wird. Der Baum trägt dieses Jahr nicht. Von vierfüßigen Thieren wird es in der anständigen Sprechart für "trächtig seyn" gebraucht. Die Kuh trägt. Eine tragende Kuh, im gemeinen Leben eine Trächtige. Ingleichen von leblosen Dingen, wie "bringen" und "eintragen". Nutzen tragen, bringen. Ein Güt, welches nicht viel trägt, d. i. einträgt, Gewinn bringt. Das Capital trägt 6 pro Cent, bringt so viele Zinsen ein.
(2) Als ein Gewehr, noch mehr aber als ein Kleidungsstück an sich haben. Einen Degen tragen. Was die Waffen tragen kann. Die Muskete tragen, auch, ein Musketier seyn. Eine goldene Kette an dem Halse, einen Ring an dem Finger tragen. Eine Perrücke tragen. Sein eigenes Haar tragen. Schuhe, Strümpfe, Stiefel tragen. Ein schwarzes Kleid, einen seidenen Rock, einen groben Kittel tragen. Den Kranz mit Ehren tragen. Wo tragen bald von dem Zeitpuncte, von welchem man spricht, bald auch von der gewöhnlichen Kleidung gebraucht wird. ( S. "Tracht".) Ingleichen als ein Reciprocum, "sich tragen", gewöhnlich gekleidet seyn, mit näherer Bezeichnung der Art und Weise. Sich prächtig, einfach, vornehm, gemein tragen. Sich schwarz tragen. Du wirst dich bald wie eine Dame zu tragen wissen, Weiße. Wer sich trägt, wie die Alten gingen, der ist ehrbar und sittsam, Gell. Eben dieses Reciprocum wird zuweilen auch von dem Zeuge oder Kleidungsstücke gebraucht. Der Zeug trägt sich gut, wenn er, indem man ihn trägt, nicht schlechter wird.
(3) Etwas tragen, es über sich ergehen lassen, erdulden. Die Kosten tragen. Die Reisekosten zur Hälfte tragen. Jemandes Schuld tragen, für eines andern Vergehen büßen. Der Sohn soll nicht tragen die Missethat des Vaters, Ezech. 18, 20. Des Tages Last und Hitze tragen. Sein Kreuz geduldig tragen. Ingleichen Vermögen, Neigung haben, etwas zu dulden oder zu erdulden, wie ertragen. Das Land kann die Auflagen nicht tragen. Ihr könnets jetzt nicht tragen. Joh. 16, 12. Der Wohlstand ist oft schwerer zu tragen, als der Unfall, Gell. Der Schwachen Gebrechen tragen, "dulden". Sprich bey dir selbst, Gott trägt die Frechen, Gell. Gott wolle nicht, daß er mir je so begegne, ich würde das nicht tragen können.
(4) Von dem Körper und einigen Theilen desselben gebraucht, ist tragen so viel als "halten". Den Kopf hoch tragen, ihn in seiner gewöhnlichen Stellung hoch halten. Den Kopf schief tragen. Die Nase hoch tragen. Seinen Leib gerade tragen. Ingleichen als ein Reciprocum, von der ganzen Stellung. Er trägt sich sehr gerade. Wie geschickt trägt er sich nicht! Gell. In noch weiterer Bedeutung wird sich betragen auch von den Handlungen gebraucht. Das Tragen der Stimme, in der Musik, nach dem Ital. il Portamento di voce, die genaue und sanfte an einander Schließung der Töne von dem Sänger, daß sie nur ein einziger lang gedehnter Hauch zu seyn scheinen. Der Sänger weiß die Stimme gut zu tragen.
(5) Davon "tragen", "erhalten", "bekommen". Den Sieg davon tragen. Ehre, Schimpf, Schande davon tragen. Derbe Stöße, eine Tracht Schläge davon tragen. Narben, Wunden davon tragen.
(6) Einen Gedanken mit sich herum tragen, demselben ununterbrochen nachhängen. Man trägt sich mit einem Gerüchte, es gehet ein unbestimmtes Gerücht. Er hat sich schon lange mit der Sache getragen, hat die Sache schon lange im Sinne gehabt.
(7) In einigen Fällen wird es auch für "einschreiben", "verzeichnen" gebraucht. Etwas in ein Buch tragen, "verzeichnen". Eine Summe in die Rechnung tragen. Jemandes Nahmen auf die Liste tragen. S. auch "Eintragen".
(8) Ingleichen für "führen", "haben", doch nur in einigen Fällen. Jemandes Nahmen tragen, haben, führen. Gewalt tragen, haben, führen. Ein Amt tragen, bekleiden. Kraft meines tragenden Amtes, ein schon von andern gerügter Mißbrauch des thätigen Mittelwortes, für: Kraft des Amtes, welches ich trage; indem das Amt hier nicht trägt, sonder getragen wird.
(9) Noch häufiger wird es von fast allen Gemüthsbewegungen und Neigungen für "haben" gebraucht, wo es zwar die vierte Endung zu sich nimmt, aber doch im Passivo nicht üblich ist. Liebe zu oder gegen jemanden tragen. Viele Achtung, Freundschaft für jemanden tragen. Haß, Feindschaft gegen jemanden tragen. Trägst du keine Scheu, mich so zu beleidigen? Die Sorge, welche ich für dich trage. An solchen Dingen trage ich keinen Gefallen. Ich sage es ihnen, daß ich eben den Gehorsam gegen sie trage, den ich meinem Vater schuldig bin, Gell. Ekel für etwas tragen. Hingegen sagt man nicht Gram, Traurigkeit, Freude, Betrübniß tragen; ausgenommen zuweilen mit Bezeichnung des Ortes. Der Gram, welchen ich in meinem Herzen trage. Hierher gehören ohne Zweifel auch die R. A. Leid um etwas tragen, um etwas trauern, Gram darum empfinden, und selbiges äußern; obgleich solche von andern als eine Figur des Tragens der Kleider angesehen, und durch Trauerkleider tragen, erkläret wird. Der Büsche traurig Grün, scheint Leid um mich zu tragen, Cron.
2) Als ein Neutrum mit dem Hülfsworte "haben", wovon doch die meisten Fälle schon im vorigen angeführet worden. Hier soll nur derjenigen Bedeutung gedacht werden, in welcher tragen zuweilen für "reichen" gebraucht wird, welches Wort selbst damit verwandt zu seyn scheinet. In dieser Bedeutung gebraucht man es theils von allen Schießgewehren, theils auch von dem Sehen in die Ferne, und allen Werkzeugen desselben. Die Kanone trägt nicht so weit, die daraus geschossene Kugel geht nicht so weit. Das Gewehr trägt hundert Schritt. Meine Augen tragen nicht so weit, ich kann nicht so weit in die Ferne sehen. So weit nur der Blick trägt. Das Fernglas trägt sehr weit. So auch das Tragen in allen Bedeutungen des Activi, und in einigen wenigen auch wohl die "Tragung".
Anm. In dieser dritten Hauptbedeutung schon in Isidor "dragan", bey dem Kero "tragan", bey dem Ottfried "druagen", (von welcher veralteten Form das irreguläre Imperfectum herrühret,) ingleichen "dragan", im Nieders. "drägen", im Angels. "dragan". Die Bedeutung des "Ziehens" scheinet eine der ersten Bedeutungen dieses Wortes gewesen zu seyn. In den Zusammensetzungen "austragen", "betragen", "sich zutragen" u. s. f. hat es noch verschiedene andere Bedeutungen, welche in dem einfachen Zeitworte veraltet sind. (S. auch "Trachten".) Die Latein. "ferre" und "portare", sind ohne Zweifel mit dem im Hochdeutschen veralteten, aber noch in Niederdeutschen üblichen "bähren", "heben", "tragen", verwandt. Da das "g" in diesem Worte gelinde lautet, so können die Zusammensetzungen desselben im Hochdeutschen das "e" euphonicum nicht entbehren; Trageband, Tragestollen u. s. f. "Tragbar" und "träglich" ausgenommen, welche dieses "e" nicht leiden.
Den "Prügel" habe ich nun ganz vergessen. Dazu findet man bei Adelung:
Der "Prügel", des -s, plur. ut nom. sing.
1) Ein dicker unförmlicher Stock, besonders so fern er bestimmt ist, damit zu schlagen. Mit einem Prügel schlagen. Jemanden mit dem Prügel bewillkommen. In weiterer Bedeutung, wird es zuweilen von einem jeden dicken runden aber unförmlichen Holze gebraucht. So werden die Knüttel, welche man zuweilen in die morastigen Wege legt, um eine Art Dämme oder Brücken daraus zu machen, in manchen Gegenden Prügel genannt.
2) Ein Schlag mit einem Prügel oder ähnlichen Werkzeuge, und in den niedrigen Sprecharten ein Schlag mit einem jeden Stocke, nach einer nicht ungewöhnlichen Vergrößerung. Jemanden Prügel geben. Prügel austheilen, bekommen. Jemanden zwanzig Prügel geben lassen, zwanzig Stockschläge auf den Rücken. Eine Tracht Prügel bekommen, so viel als man ertragen kann. Die "Prügelsuppe", auch nur in den niedrigen Sprecharten, eine "Tracht Prügel".
Anm. Die Sylbe "-el" bezeichnet in der ersten Bedeutung ein Werkzeug, und in der zweyten ein Ding, ein Subject. "Prügel" setzt also ein Zeitwort voraus, welches "prügen", "brügen", gelautet, und schlagen bedeutet hat, von welchem das folgende "prügeln" das Intensivum oder Frequentativum ist. (S. dasselbe.) Im Wendischen ist "pru" gleichfalls "prügeln", welches aber aus "peru" zusammen gezogen ist, welches mit dem noch in vielen Gegenden üblichen "bären", "bohren", "pehren", "heftig schlagen", Latein. "ferire", überein kommt, daher es dahin stehet, ob nicht unser "prügeln" gleichfalls aus "pehrgeln" zusammen gezogen oder vielmehr durch Versetzung des "r" daraus entstanden ist.
"Prügeln", verb. reg. act. "heftig schlagen", "sehr schlagen", doch nur wenn der Gegenstand der heftigen Schläge ein Mensch oder Thier ist. Jemanden prügeln oder prügeln lassen. In einigen Gegenden prügelt man auch die Hunde, wenn man ihnen einen Prügel oder Knüttel an den Hals hänget, welches sonst auch "bängeln", "knütteln" und "knüppeln" heißt. Daher das Prügeln.
Anm. Entweder als das Intensivum oder Frequentativum von dem bey dem vorigen Worte gedachten veralteten "prugen", "schlagen", oder auch unmittelbar von "Prügel", so wie die Nieders. "tageln" und "knüppeln" beyde in der Bedeutung des heftigen Schlagens von "Tagel" und "Knüppel" abstammen. Die "Prügeley" für "Schlägerey", und "Prügelsuppe", eine "Tracht Prügel", sind in den gemeinen Sprecharten bekannt. Eben diese Sprecharten sind überaus reich, das Schlagen oder Prügeln nach allen Schattirungen und Nebenbegriffen auszudrücken. (S. "Schlagen", wo einige derselben werden angeführet werden.)
(E?)(L?) http://www.dw.com/de/wilhelm-busch-ein-meister-der-ironie/l-18928023
...
Max und Moritz werden nicht einfach nur zu Saatkörnern, sie wurden gesät als Saat der Anarchie. Wenn diese Saat heranwächst, wachsen auch diegesetzlosen Zustände im Land. Das zumindest ist die Theorie des Germanistikprofessors. Ob Busch das wirklich sagen wollte, ist nicht bewiesen, zumal die Saat gar nicht aufgehen konnte. Die Körner wurden nämlich von Gänsen gefressen. Ziemlich sicher ist aber, dass Max und Moritz auch ein wenig autobiografisch ist: Max sah Buschs bestem Freund aus Kindertagen, dem Müllersohn Erich Bachmann, sehr ähnlich, und beide liebten es, anderen Streiche zu spielen. So war Wilhelm zehn Jahre alt, als er von seinem Onkel eine gehörige "Tracht Prügel" bezog, weil er einem Dorfbewohner die Pfeife mit Kuhhaar gefüllt hatte. Die Lust an der Schadenfreude behielt Busch trotz der Schläge:
...
(E?)(L?) http://www.koeblergerhard.de/der/DERT.pdf
"Tracht", F., "Tracht", mhd. "trahte", F., "Denken", "Betrachtung", "Fischzug", "aufgetragene Speise", mhd. "traht", F., "Tragen", "Last", "Denken", "aufgetragene Speise", ahd. "traht" (12. Jh.), M., "Trachten", ahd. "trahta" (863-71), F., "Trachten", "Denken", "Zugnetz", "aufgetragene Speise", zu "tragen", V., "tragen"
"trachten", V., "trachten", "streben", mhd. "trahten", V., "erwägen", "bedenken", "beachten", "trachten", ahd. "trahten" (863-71), V., "betrachten", ahd. "trahton" (nach 765?), V., "betrachten", "trachten", "behandeln", as. "trahton", V., "betrachten", "behandeln", germ. "*trahten", V., "trachten", Lw. lat. "tractare", V., "behandeln"
"tragen", V., "tragen", mhd. "tragen", V., "tragen", "haben", "besitzen", "ertragen", ahd. "tragan" (765), V., "tragen", "ertragen", "bringen", "empfangen", "haben", as. "dragan", V., "tragen", germ. "*dragan", V., "ziehen", "schleppen", idg. "*dher—gh-", V., "ziehen", "schleifen"?, zu idg. "*tr—gh-", V., Sb., "ziehen", "schleppen", "laufen", "Nachkommen"?
(E?)(L?) http://www.marquise.de/de/ethno/bayern/tracht.shtml
Der Begriff "Tracht" ist ein hart umkämpfter. Ähnlich wie bei "Kultur" gibt es ungefähr so viele Definitionen wie Leute, die sich damit befassen.
Der Begriff
"Tracht" ist etymologisch verwandt mit "tragen", d.h. es ist das, was man trägt (s. auch trächtig), was man auf einmal tragen kann (z.B. eine Tracht Holz) oder ertragen kann (eine Tracht Prügel). Tracht im textilen Sinn ist das, was man auf dem Leib trägt. Also Kleidung. Von Tradition oder regionalen Unterschieden ist an dem Begriff zunächst überhaupt nichts dran. Erst durch Kontext und Interpretation verengt sich der Trachtenbegriff.
...
(E?)(L?) http://ping.eu/traceroute/
Traceroute - Traces the route of packets to destination host from our server
(E?)(L?) https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/BarksThierleben2%20klein.pdf
Wildaffe
Simia comata
Ordnung: Primates (Primaten)
Familie: Pongidae (Menschenaffen)
Exemplare dieser Entenhausener Affenart werden gerne als Zirkusaffen (Künstlername z.B.: „Drei Wilde Affen“) gehalten. Ihr Habitus erinnert entfernt an Schimpansen. Sie verfügen über einen charakteristischen Haarschopf. Die Extremitäten sind tetradaktyl, jeweils der erste Finger und die erste Zehe sind opponierbar, so dass typische Greifhände und -füße entstehen. Der Schwanz ist fast zur Gänze reduziert.
Das Verhaltensmuster des Entenhausener Wildaffen als Horde ist komplex: Reviereindringlinge werden einer Sequenz von Bestrafungen unterzogen (Plätten, Herumwirbeln, Trampolinspringen, "Tracht Prügel"). Dieses Verhalten tritt auch bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren auf (hier tritt dann noch Schmirgeln und Bürsten als Bestrafung hinzu) und kann nur durch erfahrenes Zirkuspersonal beherrscht werden.
WDC 60; TGDD 4 „Das Radargerät“; BL-WDC 6/4
(E3)(L1) https://www.redensarten-index.de/register/a.php
jemandem eine Tracht Prügel verpassen
(E?)(L?) http://fr.wiktionary.org/wiki/tragen?match=en
(E1)(L1) http://books.google.com/ngrams/graph?corpus=8&content=Tracht Prügel
Abfrage im Google-Corpus mit 15Mio. eingescannter Bücher von 1500 bis heute.
Dt. "Tracht Prügel" taucht in der Literatur um das Jahr 1750 auf.
(E?)(L?) https://corpora.uni-leipzig.de/
Erstellt: 2018-06